Tipps
Unsere Tipps für den Umgang mit IGeL-Angeboten.
weiterlesen
Kann der PSA-Test Männer davor bewahren, an Prostatakrebs zu sterben?
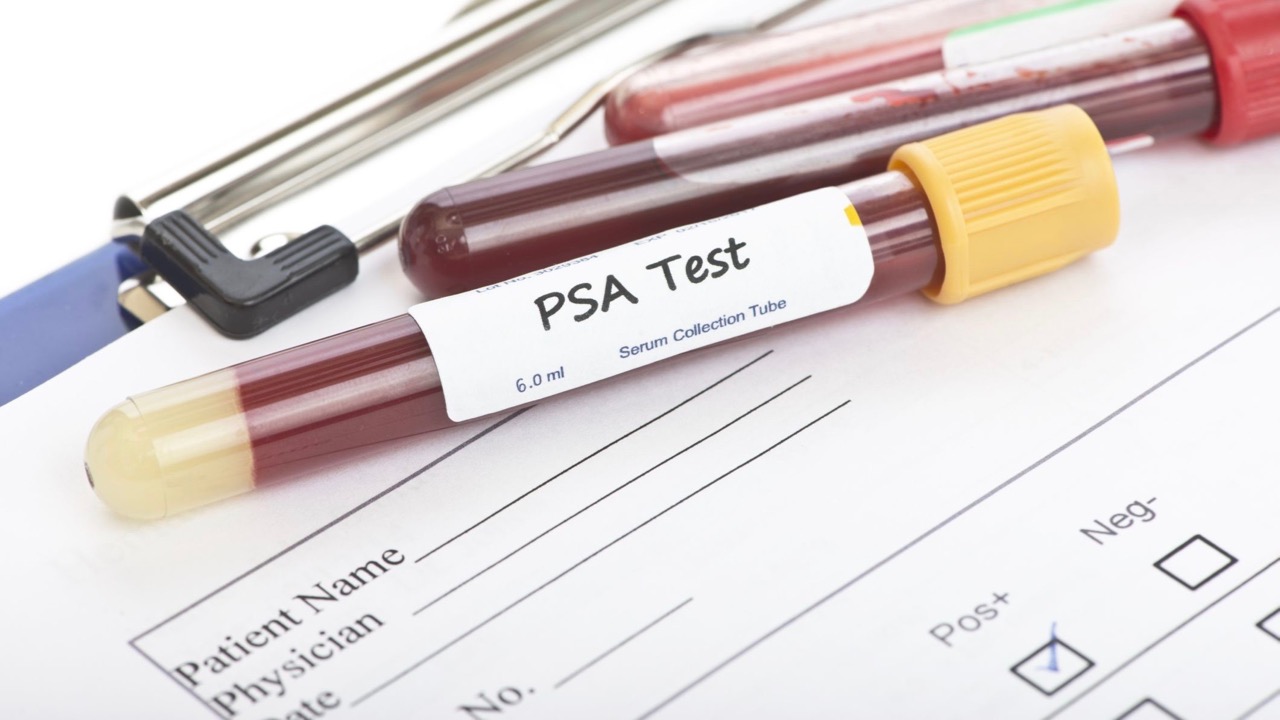
| Fachgebiete | Allgemeinmedizin , Urologie |
|---|---|
| Bereich | Prostata |
| Anlass | Früherkennung von Prostatakrebs |
| Verfahren | Messung von Substanzen im Blut |
| Kosten | Inkl. Beratung zwischen 25 und 35 Euro |
| GKV-Leistung | Jährliches Abtasten der Prostata ab dem Alter von 45 zur Krebsfrüherkennung; PSA-Test bei konkretem Krebsverdacht (z. B. tastbarem Knoten) sowie zur Verlaufskontrolle bei Prostatakrebs; weitere Untersuchungen wie Gewebeentnahmen und Ultraschalluntersuchung der Prostata bei konkretem Krebsverdacht |
Den PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs bewerten wir als „tendenziell negativ“.
Der PSA-Test ist eine der am häufigsten angebotenen IGeL. Er soll Prostatakrebs früh erkennen und Männer davor bewahren, an Prostatakrebs zu sterben. Auch wenn der PSA-Test von vielen Urologen und Allgemeinärzten als sinnvolle Vorsorgemaßnahme dargestellt wird, gibt es seit Jahren auch in Fachkreisen intensive Diskussionen um Nutzen und Schaden des Tests. Der PSA-Test gehört nicht zum Krebsfrüherkennungsangebot der GKV . Zur Früherkennung des Prostatakrebses bezahlen die Kassen bei Männern ab 45 Jahren ein jährliches Abtasten der Prostata.
Was sagen wissenschaftliche Studien über Nutzen und Schaden ? Von fünf großen Studien zeigen nur zwei, dass der PSA-Test Männer davor bewahren kann, am Prostatakrebs zu sterben. Eine der Studien aus den USA, die keinen Vorteil für den PSA-Test gefunden hat, wurde später kritisiert: Die Studie sei wertlos, da in der Kontrollgruppe ebenso viele Männer einen PSA-Test hätten machen lassen wie in der PSA-Gruppe. Diese Vorwürfe haben wir in unserer Bewertung berücksichtigt. Was mögliche Schäden angeht, zeigen die Studien übereinstimmend, dass der PSA-Test auch Tumore findet, die den Männern mit hoher Wahrscheinlichkeit nie Beschwerden bereitet hätten. Man kann sagen: Auf einen Mann, der dank PSA-Test nicht am Prostatakrebs stirbt, kommen vermutlich 30 Männer, die unnötig behandelt werden, weil ihr Tumor zeitlebens gar nicht aufgefallen wäre. Insgesamt sehen wir Hinweise auf einen Nutzen, und Belege für einen Schaden.
Nach unserer Abwägung bewerten wir den PSA-Test zur Früherkennung deshalb mit „tendenziell negativ“. Jeder Mann sollte jedoch selbst abwägen. Denn Studien können zwar ermitteln, wie wahrscheinlich und wie häufig Nutzen und Schaden auftreten, aber welchen Wert man auf der einen Seite der Aussicht auf ein längeres Leben und auf der anderen Seite unnötigen Behandlungen beimisst, muss jeder für sich entscheiden.
Erstellt am:
Letzte Aktualisierung:
Bild: Thinkstock
https://www.igel-monitor.de/igel-a-z/igel/show/psa-test-zur-frueherkennung-von-prostatakrebs.html
| Fachgebiete | Allgemeinmedizin , Urologie |
|---|---|
| Bereich | Prostata |
| Anlass | Früherkennung von Prostatakrebs |
| Verfahren | Messung von Substanzen im Blut |
| Kosten | Inkl. Beratung zwischen 25 und 35 Euro |
| GKV-Leistung | Jährliches Abtasten der Prostata ab dem Alter von 45 zur Krebsfrüherkennung; PSA-Test bei konkretem Krebsverdacht (z. B. tastbarem Knoten) sowie zur Verlaufskontrolle bei Prostatakrebs; weitere Untersuchungen wie Gewebeentnahmen und Ultraschalluntersuchung der Prostata bei konkretem Krebsverdacht |
Der PSA-Test soll Prostatakrebs früh erkennen und eine rechtzeitige Behandlung ermöglichen, so dass der Tod durch die Krankheit verhindert werden kann. „PSA“, das für „Prostata-spezifisches Antigen“ steht, ist ein Eiweiß-Molekül, das überwiegend von der Prostata produziert wird. Prostatakrebs-Zellen produzieren oft besonders viel PSA, das auch ins Blut gelangt, weshalb dort erhöhte Werte auf einen Krebs hinweisen können. Wird der PSA-Test zur Abklärung eines Krebsverdachts eingesetzt, etwa wenn der Arzt einen harten Knoten an der Prostata ertastet hat, ist er eine GKV -Leistung. Soll verfolgt werden, wie sich ein Prostatakrebs entwickelt oder ob er nach einer Behandlung wieder aktiv wird, ist der PSA-Test ebenfalls eine GKV-Leistung. Nur zur Früherkennung ist er eine IGeL. Er kostet mit Beratung in der Regel zwischen 25 und 35 Euro.
Prostatakrebs ist weit verbreitet. Er ist mit 14.000 Todesfällen hinter dem Lungenkrebs die zweithäufigste Krebstodesursache der Männer. Prostatakrebs betrifft vor allem ältere Männer: Er wird im Durchschnitt mit 71 Jahren festgestellt. Da er zudem langsam wächst, sterben viele Prostatakrebs-Patienten nicht an ihrem Krebs, sondern an etwas anderem. So kommt der Prostatakrebs bei Männern unter 65 Jahren bei der Häufigkeit der Todesursachen erst an 24. Stelle.
Seit 1980 hat sich die Zahl der jährlich neu entdeckten Prostatakrebsfälle verdoppelt. Ein Grund dafür ist die älter werdende Bevölkerung. Immer mehr Männer erleben also überhaupt das Alter, in dem dieser Krebs hauptsächlich auftritt. Hauptursache für den starken Anstieg der entdeckten Krebsfälle ist jedoch der PSA-Test. Man kann also sagen, dass die große Verbreitung des PSA-Tests zwei Effekte hat: Eine gewisse Anzahl von Männern ist eventuell vor dem Tode durch Prostatakrebs bewahrt worden, aber sicher sind viele Männer unnötig zu Krebspatienten geworden, die ohne Test nie von ihrem Krebs erfahren hätten, und möglicherweise auch nie gesundheitliche Probleme dadurch bekommen hätten. Das heißt, eine große Anzahl an Männern muss mit den Folgen von Operation, Bestrahlung und Hormontherapie leben, obwohl man ihren Krebs gar nicht behandeln hätte müssen.
Liegt ein PSA-Wert über dem Wert von 4 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml), sollte der Arzt eine Gewebeprobe aus der Prostata entnehmen. Bestätigt sich der Verdacht, gibt es je nach Größe und Aggressivität des Tumors mehrere Möglichkeiten: Man kann abwarten, wie sich der Krebs weiter entwickelt, oder man kann die komplette Prostata operativ entfernen oder bestrahlen. Auch eine Behandlung mit Hormonen, die die Bildung des männlichen Geschlechtshormons Testosteron blockieren kann in Frage kommen.
Das PSA ist ein Enzym, das der Samenflüssigkeit beim Erguss beigemischt, um die Beweglichkeit der Samen zu erhöhen. Das PSA gelangt nur dann ins Blut, wenn das Prostatagewebe gestört ist. Das kann auch nach einer Manipulation, fortgesetztem Druck einer langen Fahrradfahrt, bei einer Entzündung oder bei einer gutartigen Vergrößerung der Prostata der Fall sein. Ein PSA-Wert kann also auch ohne Krebs erhöht sein. Ein auffällig hoher Wert wird deshalb zunächst dazu führen, dass der Test wiederholt wird. Ist auch der zweite Test auffällig, wird zur Entnahme einer Gewebeprobe aus der Prostata geraten. In einem Teil der Fälle kann dann „Entwarnung“ gegeben werden, denn es finden sich keine Krebszellen. Der Test war dann „falsch positiv“. Umgekehrt führt nicht jeder Prostatakrebs zwangsläufig zu hohen PSA-Werten, der Test kann also auch „falsch negativ“ ausfallen.
Grundsätzlich gilt aber: Je höher der PSA-Wert ist, desto wahrscheinlicher geht er auf einen Krebs zurück. Einen klaren Grenzwert gibt es aber nicht.
Der PSA-Test wurde 1986 entwickelt und bald darauf als Früherkennungs-Verfahren propagiert. Neben dem herkömmlichen PSA-Blut-Test, der im Labor ausgewertet wird, gab es auch Versuche, den Test über die Apotheken als einfachen Streifentest anzubieten, wogegen sich die Urologenverbände wehrten. Auch wurden neue Verfahren entwickelt, die zwischen zwei Varianten des PSA unterscheiden. Und schließlich wurde versucht, über den Verlauf des PSA über einen gewissen Zeitraum das Krebsrisiko genauer einschätzen zu können als mit isolierten Messwerten.
Unter Leitung der Deutschen Gesellschaft für Urologie und der Deutschen Krebshilfe haben etliche Fachgesellschaften im Jahr 2016 die S3-Leitlinie „Zur Früherkennung, Diagnose und Therapie der verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms“ veröffentlicht. Sie empfiehlt: „Männer, die mindestens 45 Jahre alt sind und eine mutmaßliche Lebenserwartung von mehr als 10 Jahren haben, sollen prinzipiell über die Möglichkeit einer Früherkennung informiert werden. Bei Männern mit erhöhtem Risiko für ein Prostatakarzinom kann diese Altersgrenze um 5 Jahre vorverlegt werden. Die Männer sollen über die Vor- und Nachteile der Früherkennungsmaßnahmen aufgeklärt werden, insbesondere über die Aussagekraft von positiven und negativen Testergebnissen sowie über gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen.“ Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), die ebenfalls an der Leitlinie mitgewirkt hat, hat in einem Sondervotum betont, dass in der Hausarztpraxis Männer nicht auf den PSA-Test angesprochen werden sollen. Nur wenn sie von sich aus danach fragen, sollen sie darüber informiert werden.
Differenzierte Empfehlungen hat der US-amerikanische Urologenverband AUA veröffentlicht: Die AUA rät davon ab, dass Männer unter 54 sowie über 70 Jahren sowie bei Männern mit einer Lebenserwartung von unter 10 bis 15 Jahren routinemäßig getestet werden. Männer zwischen 55 und 69 sollen ausführlich über Vor- und Nachteile des PSA-Tests informiert werden. Wenn sie sich für den Test entscheiden, soll zweijährlich getestet werden.
Darüber hinaus wurden fünf weitere Leitlinien gefunden, von denen keine eine generelle, routinemäßige PSA-Untersuchung gesunder Männer empfiehlt.
Der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs wäre nützlich, wenn er den Tod durch Prostatakrebs verhindern könnte.
Die Wissenschaftler des IGeL-Monitors bezogen in ihre Analyse fünf Studien ein. Jede Studie untersuchte zwei Gruppen von Männern: Die einen Männer sollten mit einem PSA-Test untersucht werden, die anderen nicht. In ihren sonstigen Kenngrößen unterschieden sich die Studien deutlich: An der kleinsten Studie waren gut 9000 Männer beteiligt, an der größten über 160.000; die untere Altersgrenze der Männer lag bei 45 bis 55, die obere bei 69 bis 80; die Ergebnisse, wie viele Männer in den Gruppen an Prostatakrebs gestorben waren, wurden nach 10 bis 20 Jahren erhoben; die Grenze, ab dem von einem positiven PSA-Test gesprochen wurde, lag bei 3 bis 7 Nanogramm pro Milliliter; Häufigkeit und Anzahl der Tests schwankten zwischen den Studien, auch wurden Tastbefunde und Ultraschall unterschiedlich einbezogen.
Trotz dieser gewaltigen Datenmenge sind die Ergebnisse nicht so klar, wie man erwarten sollte. In der größten Studie , der europäischen ERSPC-Studie mit über 160.000 Männern waren nach 13 Jahren in der PSA-Gruppe deutlich weniger Männer am Prostatakrebs gestorben als in der Gruppe ohne PSA-Test. Man kann aus dieser Studie schließen: Wenn 80.000 Männer im Alter von 55 bis 69 Jahren alle vier Jahre einen PSA-Test machen lassen, führt das dazu, dass 100 Männer nicht an Prostatakrebs sterben. Umgerechnet bedeutet das: Damit ein Mann davor bewahrt wird, innerhalb von 13 Jahren nicht an Prostatakrebs zu sterben, müssen sich 1000 Männer alle vier Jahre mit dem PSA-Test untersuchen lassen. Eine weitere, nicht so aussagkräftige Studie zeigte ebenfalls, dass Männer vom PSA-Test profitieren können.
Die drei anderen Studien jedoch zeigten keine Vorteile für die Männer mit PSA-Test. Eine dieser Studien ist die sogenannte PLCO- Studie , die in jüngster Zeit in die Diskussion geraten ist, weil auch in der Kontroll-Gruppe sehr viele Männer einen PSA-Test machen ließen, sozusagen auf eigene Faust. Durch diese „Verunreinigung“ der Kontrollgruppe wurde ein möglicherweise vorhandener Effekt des PSA-Tests eventuell zunichte gemacht.
Es wurde auch nach Studien gesucht, die einen Nutzen des PSA-Tests im Vergleich zum Nutzen des Abtastens der Prostata untersucht haben. Diese Frage wäre insofern wichtig, als das Abtasten Kassenleistung ist. Es wurden jedoch keine Studien gefunden.
Ob der PSA-Test dazu beitragen kann, dass unabhängig von der Todesursache insgesamt weniger Männer sterben, muss offen bleiben, da die Studien nicht dafür ausgelegt waren, diese Frage zu beantworten.
Aufgrund der uneinheitlichen Studienergebnisse sehen wir keine Belege , aber Hinweise auf einen Nutzen .
Der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs wäre dann schädlich, wenn der Test selbst oder sich daraus ergebende Maßnahmen die Lebensqualität beeinträchtigen oder eine Gesundheitsgefahr darstellen würden.
Der Test selbst, also die Blutabnahme, ist nicht schädlich.
Der Test löst jedoch viele Fehlalarme aus. Dass ein verdächtig hoher PSA-Wert nicht auf einen Krebs hinweist und deshalb ein Fehlalarm ist, kann oft erst durch eine Gewebeprobe festgestellt werden. In vielen Fällen findet die Gewebeprobe keine Krebszellen. Die Männer sind dann zwar erleichtert, für die Gewebeprobe müssen jedoch Zellen aus der Prostata herausgestanzt werden. Das kann zu Komplikationen wie Infektionen, Blutungen und Schmerzen führen.
Ein weiterer möglicher Schaden kann dadurch entstehen, dass der Test Tumore übersieht. So besteht nach einem unauffälligen PSA-Wert die Gefahr, dass Patienten Warnzeichen des Körpers nicht ernst nehmen und deshalb unnötig spät mit einer Behandlung beginnen.
Der größte Schaden des PSA-Tests entsteht durch die so genannten Überdiagnosen und Übertherapie n: In den Studien werden in den Gruppen mit PSA-Test deutlich mehr Tumore gefunden und auch behandelt als in den Gruppen ohne PSA-Test. In der großen ERSPC- Studie wurden in der PSA-Gruppe über 8000 Diagnosen gestellt, in der Kontrollgruppe dagegen nur 5500. Das heißt: Wenn 1000 Männer im Alter von 55 bis 69 Jahren alle vier Jahre einen PSA-Test machen lassen, führt das dazu, dass etwa 30 Männer mehr die Diagnose Prostatakrebs bekommen. Setzt man diese Zahl ins Verhältnis zum Nutzen , heißt das: Damit ein Mann nicht an Prostatakrebs stirbt, müssen etwa 30 Männer die Diagnose Prostatakrebs und die Folgen der Therapie in Kauf nehmen.
Drei der vier weiteren Studien zeigten ebenfalls, dass in der PSA-Gruppe mehr Tumore gefunden wurden. Eine Studie machte dazu keine Angaben.
Man kann aus diesen Zahlen schließen, dass der größte Teil der mit dem PSA-Test zusätzlich gefundenen Tumore wahrscheinlich niemals auffällig geworden wäre, wenn man nicht nach ihnen gesucht hätte. Man weiß aber nicht, welchen Mann das im Einzelfall betrifft. So werden als Folge des PSA-Tests äußerlich gesunde Männer, bei denen der gefundene Tumor niemals aufgefallen wäre, als Krebspatienten behandelt, was zum Teil gravierende Nebenwirkungen mit sich bringen kann: Hormonbehandlungen können den Knochenabbau beschleunigen und zu Impotenz führen, Operationen und die Bestrahlung können ebenfalls zu Impotenz sowie zu Inkontinenz führen. Die Angaben darüber, wie oft diese schwerwiegenden Nebenwirkungen auftreten, schwanken erheblich.
Die gefundenen Studien zeigen einheitlich, dass ein PSA-Test zur Früherkennung des Prostatakarzinoms zu Schäden führt, vor allem durch Überdiagnosen und Übertherapie n. Wir sehen deshalb nicht nur Hinweise , sondern Belege für Schäden.
Wir bewerten den PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs als „tendenziell negativ“: Die Datenlage lässt unserer Ansicht nach den Schluss zu, dass es Hinweise auf einen Nutzen gibt, und Belege für Schäden. In unserer Abwägung gewichten wir den Schaden deshalb höher als den Nutzen.
Diese Abwägung schließt nur die beiden Kriterien ein, die sich in Studien ermitteln lassen, nämlich die Häufigkeit von Nutzen und Schaden sowie die Aussagekraft der Ergebnisse. Ein ganz entscheidendes Kriterium muss jedoch jeder Mann für sich selbst in die Waagschale werfen: Wie wichtig sind ihm Nutzen und Schaden? Er muss also entscheiden, was für ihn schwerer wiegt: Auf der einen Seite steht die Chance, nicht an einem Prostatakrebs zu sterben. Diese Chance ist in Studien nicht so gut belegt, relativ selten, aber dafür vermutlich sehr wichtig. Auf der einen Seite steht vor allem das Risiko, unnötigerweise wegen eines Prostatakarzinoms behandelt zu werden, das ohne PSA-Test niemals auffällig geworden wäre. Dieses Risiko ist durch Studien gut belegt, relativ hoch, aber dafür vermutlich nicht so wichtig (im Vergleich zur Chance, nicht zu sterben).
Diese Bewertung gilt für Männer, die einen PSA-Test machen lassen im Vergleich zu Männern, die nichts unternehmen. Sinnvoll wäre auch ein Vergleich des PSA-Tests mit dem Abtasten der Prostata, das als jährliche Maßnahme zur Früherkennung von Prostatakrebs für Männer ab 45 von den Kassen übernommen wird. Wir fanden jedoch keine Studien, die diese beiden Maßnahmen miteinander vergleichen.
Erstellt am:
Letzte Aktualisierung:
Bild: Thinkstock
https://www.igel-monitor.de/igel-a-z/igel/show/psa-test-zur-frueherkennung-von-prostatakrebs.html
Download: Merkblatt herunterladen
233
KB | PDF-Dokument
Hinweis: Diese PDF ist nicht barrierefrei
Erstellt am:
Letzte Aktualisierung:
Bild: Thinkstock
Erklärung der Bewertung: positiv: Unserer Ansicht nach wiegt der Nutzen der IGeL deutlich schwerer als ihr Schaden
Erklärung der Bewertung: tendenziell positiv: Unserer Ansicht nach wiegt der Nutzen der IGeL geringfügig schwerer als ihr Schaden
Erklärung der Bewertung: unklar: Unserer Ansicht nach sind Nutzen und Schaden der IGeL ausgewogen, oder wir finden keine ausreichenden Daten, um Nutzen und Schaden zu beurteilen
Erklärung der Bewertung: tendenziell negativ: Unserer Ansicht nach wiegt der Schaden der IGeL geringfügig schwerer als ihr Nutzen
Erklärung der Bewertung: negativ: Unserer Ansicht nach wiegt der Schaden der IGeL deutlich schwerer als ihr Nutzen
Erklärung der Bewertung:
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite notwendige Cookies gesetzt. Mit Ihrer Zustimmung zu Statistik-Cookies helfen Sie uns, die Nutzung dieser Webseite zu analysieren und unser Angebot laufend zu verbessern. Dafür setzen wir Matomo ein, dass die erfassten Daten automatisch anonymisiert. Erfahren Sie mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
„GKV“ steht für die Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Gehalt eine bestimmte Obergrenze nicht überschreitet, müssen sich in ihr versichern
"Ärztinnen und Ärzte sind je nach Spezialisierung in „Fachgesellschaften“ organisiert. Anders als die Verbände oder Genossenschaften, die die Interessen der Ärztinnen und Ärzte vertreten, bemühen sich die Fachgesellschaften um das bestmögliche und aktuellste medizinische Wissen und geben es auf Tagungen oder in Leitlinien an Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Fachrichtung sowie an Patientinnen und Patienten weiter. Übergeordnete Einrichtungen sind etwa die AWMF.
"Ärztinnen und Ärzte sind je nach Spezialisierung in „Fachgesellschaften“ organisiert. Anders als die Verbände oder Genossenschaften, die die Interessen der Ärztinnen und Ärzte vertreten, bemühen sich die Fachgesellschaften um das bestmögliche und aktuellste medizinische Wissen und geben es auf Tagungen oder in Leitlinien an Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Fachrichtung sowie an Patientinnen und Patienten weiter. Übergeordnete Einrichtungen sind etwa die AWMF.
"Ein „Fehlalarm“ ist ein zunächst auffälliger Untersuchungsbefund, der
sich bei weiteren Untersuchungen als falsch herausstellt. Er wird
fachsprachlich auch als „falsch positiver Befund“ bezeichnet. Der
Patient ist also nicht krank.
"Ein „Fehlalarm“ ist ein zunächst auffälliger Untersuchungsbefund, der
sich bei weiteren Untersuchungen als falsch herausstellt. Er wird
fachsprachlich auch als „falsch positiver Befund“ bezeichnet. Der
Patient ist also nicht krank.
"„GKV“ steht für die Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Gehalt eine bestimmte Obergrenze nicht überschreitet, müssen sich in ihr versichern
"Der „GKV-Spitzenverband“ ist die zentrale Interessenvertretung der
gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland.
"Der „GKV-Spitzenverband“ ist die zentrale Interessenvertretung der
gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland.
"Eine „Kontrollgruppe“ ist ein Bestandteil hochwertiger wissenschaftlicher (klinischer) Studien. Hier werden zwei Gruppen von Patientinnen und Patienten miteinander verglichen: Eine
Gruppe wird mit dem Verfahren, dessen Effekt ermittelt werden soll,
behandelt oder untersucht, die andere dient als Kontrollgruppe. Die
Kontrollgruppe bekommt meist ein sogenanntes Placebo, also eine
Scheinbehandlung.
"Eine „Leitlinie“ ist eine unverbindliche Handlungsanweisung für Ärztinnen und Ärzte, zum Teil auch für Patientinnen und Patienten. Man unterscheidet je nach wissenschaftlichem Aufwand S1-, S2- und S3-Leitlinien. Das Erstellen von Leitlinien wird von den medizinischen Fachgesellschaften organisiert.
"Eine „Leitlinie“ ist eine unverbindliche Handlungsanweisung für Ärztinnen und Ärzte, zum Teil auch für Patientinnen und Patienten. Man unterscheidet je nach wissenschaftlichem Aufwand S1-, S2- und S3-Leitlinien. Das Erstellen von Leitlinien wird von den medizinischen Fachgesellschaften organisiert.
"MDS ist die Abkürzung für Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V.. Der MDS ist die Vorgängerorganisation des Medizinischen Dienstes Bund. Er hat den IGeL-Monitor 2012 ins Leben gerufen und bis Januar 2022 betrieben.
"Eine „Nebenwirkung“ ist laut Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) „ein unerwünschtes Ereignis, bei dem ein
Zusammenhang zwischen der aufgetretenen Nebenwirkung und einem oder
mehreren angewendeten Arzneimittel/n von einer oder einem Angehörigen eines
Gesundheitsberufes vermutet wird, Anhaltspunkte, Hinweise oder Argumente
vorliegen, die eine Beteiligung des/der Arzneimittel für das Auftreten
der Nebenwirkung plausibel erscheinen lassen oder zumindest eine
Beteiligung der/des angewendeten Arzneimittel/s daran angenommen wird.“
"Eine „Nebenwirkung“ ist laut Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) „ein unerwünschtes Ereignis, bei dem ein
Zusammenhang zwischen der aufgetretenen Nebenwirkung und einem oder
mehreren angewendeten Arzneimittel/n von einer oder einem Angehörigen eines
Gesundheitsberufes vermutet wird, Anhaltspunkte, Hinweise oder Argumente
vorliegen, die eine Beteiligung des/der Arzneimittel für das Auftreten
der Nebenwirkung plausibel erscheinen lassen oder zumindest eine
Beteiligung der/des angewendeten Arzneimittel/s daran angenommen wird.“
"Mit „Nutzen“ ist gemeint, ob und wie sehr ein Test oder eine
Behandlungsmethode Patientinnen und Patienten nützt, indem etwa ihre Lebensqualität erhöht oder ihr Leben verlängert wird. Wir unterscheiden
„geringen“ und „erheblichen“ Nutzen, wobei sowohl Größe als auch
Häufigkeit des Nutzens berücksichtigt werden.
"Mit „Schaden“ ist gemeint, ob und wie sehr eine Untersuchung oder eine Behandlung Patientinnen und Patienten schadet, indem etwa ihre Lebensqualität verringert oder ihr Leben verkürzt wird. Wir unterscheiden „geringen“ und „erheblichen“ Schaden, wobei dabei sowohl Größe als auch Häufigkeit des Schadens berücksichtigt werden. Bei Vorsorge-, Früherkennungsuntersuchungen und invasiven Behandlungen gehen wir auch ohne Studien grundsätzlich von „Hinweisen auf einen geringen Schaden“ aus.
"Mit „Schaden“ ist gemeint, ob und wie sehr eine Untersuchung oder eine Behandlung Patientinnen und Patienten schadet, indem etwa ihre Lebensqualität verringert oder ihr Leben verkürzt wird. Wir unterscheiden „geringen“ und „erheblichen“ Schaden, wobei dabei sowohl Größe als auch Häufigkeit des Schadens berücksichtigt werden. Bei Vorsorge-, Früherkennungsuntersuchungen und invasiven Behandlungen gehen wir auch ohne Studien grundsätzlich von „Hinweisen auf einen geringen Schaden“ aus.
"Eine „Studie“ ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Eine klinische Studie testet die Wirksamkeit von medizinischen Verfahren oder Medikamenten an Patientinnen und Patienten. Studien durchlaufen verschiedene Phasen und und kommen in unterschiedlichen Qualitätsstufen vor. Die höchste Qualität und damit Aussagekraft wird einer Studie zugesprochen, bei der die Studienteilnehmenden zufällig auf zwei Gruppen verteilt werden, von denen die eine mit dem Verfahren untersucht oder behandelt wird und die andere als Kontrolle dient. Diese Studien nennt man „randomisierte kontrollierte Studien„ oder kurz RCT.
"Eine „Studie“ ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Eine klinische Studie testet die Wirksamkeit von medizinischen Verfahren oder Medikamenten an Patientinnen und Patienten. Studien durchlaufen verschiedene Phasen und und kommen in unterschiedlichen Qualitätsstufen vor. Die höchste Qualität und damit Aussagekraft wird einer Studie zugesprochen, bei der die Studienteilnehmenden zufällig auf zwei Gruppen verteilt werden, von denen die eine mit dem Verfahren untersucht oder behandelt wird und die andere als Kontrolle dient. Diese Studien nennt man „randomisierte kontrollierte Studien„ oder kurz RCT.
"Eine „Studie“ ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Eine klinische Studie testet die Wirksamkeit von medizinischen Verfahren oder Medikamenten an Patientinnen und Patienten. Studien durchlaufen verschiedene Phasen und und kommen in unterschiedlichen Qualitätsstufen vor. Die höchste Qualität und damit Aussagekraft wird einer Studie zugesprochen, bei der die Studienteilnehmenden zufällig auf zwei Gruppen verteilt werden, von denen die eine mit dem Verfahren untersucht oder behandelt wird und die andere als Kontrolle dient. Diese Studien nennt man „randomisierte kontrollierte Studien„ oder kurz RCT.
"Eine „Studie“ ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Eine klinische Studie testet die Wirksamkeit von medizinischen Verfahren oder Medikamenten an Patientinnen und Patienten. Studien durchlaufen verschiedene Phasen und und kommen in unterschiedlichen Qualitätsstufen vor. Die höchste Qualität und damit Aussagekraft wird einer Studie zugesprochen, bei der die Studienteilnehmenden zufällig auf zwei Gruppen verteilt werden, von denen die eine mit dem Verfahren untersucht oder behandelt wird und die andere als Kontrolle dient. Diese Studien nennt man „randomisierte kontrollierte Studien„ oder kurz RCT.
"Eine „Überdiagnose“ ist eine richtig erkannte Krankheit, die jedoch unauffällig geblieben wäre, wenn man nicht nach ihr gesucht hätte. Eine Überdiagnose bringt meist eine Übertherapie mit sich. Überdiagnose und Übertherapie werden als die größten Schäden von Früherkennungsuntersuchungen angesehen.
"Eine „Überdiagnose“ ist eine richtig erkannte Krankheit, die jedoch unauffällig geblieben wäre, wenn man nicht nach ihr gesucht hätte. Eine Überdiagnose bringt meist eine Übertherapie mit sich. Überdiagnose und Übertherapie werden als die größten Schäden von Früherkennungsuntersuchungen angesehen.
"Eine „Übertherapie“ ist eine unnötige Behandlung aufgrund einer „Überdiagnose“. Die Überdiagnose bezeichnet eine richtig erkannte Krankheit, die jedoch unauffällig geblieben wäre, wenn man nicht nach ihr gesucht hätte. Der Mensch ist zwar objektiv krank, hätte aber davon nichts gemerkt und unbeschwert leben können.
"